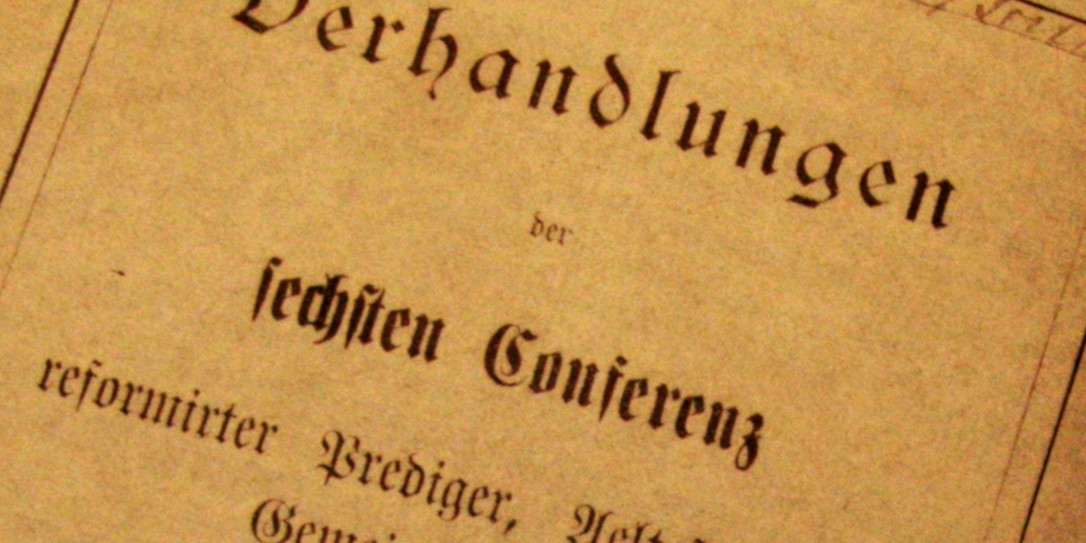Hütte und Heimat
Predigt zur 2. Kor 5, 1.10 am Vorletzten Sonntag des Kirchenjahres, 15. November 2020

Dahinten, zwischen den Bäumen, bewegt sich etwas. Die Plane schlägt gegen einen Baumstamm. Krumme, rostige Nägel halten die Bretter. Die meisten haben sich schon gelöst und hängen in einem traurigen Winkel nach unten. Das, was vom Dach übriggeblieben ist, berührt den Rest von dem, was einmal der Fußboden gewesen sein muss. Die Bretter und Planken stützen sich, als wollten sie sich gegenseitig vor dem Herunterfallen bewahren. Aber lange können sie sich bestimmt nicht mehr halten. Dann wird nichts mehr übrig sein, außer ein paar Nägeln im Baum, den verrottenden Brettern auf dem Boden und einem Stück Plastikplane im Wind.
Einen Sommer lang, vielleicht zwei, war dies ein Zuhause. Jeden Tag waren sie dort, mit Nägeln, Werkzeug, Brettern, geborgt oder geklaut. Erst der Boden - bis das alles überhaupt mal hält, hat es schon ziemlich gedauert. Dann das Dach, eine Seitenwand, für mehr reichten die Bretter nicht, deswegen die Plane. Immer gab es noch etwas zu verbessern. Jeden Tag haben sie Pläne gemacht, ein Ausguck weiter oben vielleicht, oder noch zu den anderen Bäumen hin weiterbauen. Das wurde aber nie etwas. Und irgendwann war der Sommer vorbei und es wurde schon so früh dunkel. Sie kamen nicht mehr dorthin.
Denn wir wissen: wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau, von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. (2. Kor 5,1-4) Eine Hütte im Wald, in der die Kinder spielen einen Sommer lang. Das ist unser Leben. So malt Paulus es aus. Ich sehe mir sein Bild an und ich merke: Es passt.
Wir bauen es auf, unser Leben, aus dem, was uns eben zur Verfügung steht. Das meiste ist geborgt oder geklaut. Es wackelt manchmal ganz schön. Einiges hält richtig gut. Manchmal fehlt eine Seitenwand, dann geht es irgendwie anders. Immer machen wir noch Pläne, und es wird was draus oder auch nicht. Es ist viel Arbeit, aber wir tun sie gerne, jeden Tag. Und manchmal sitzen wir einfach da. Dann ist es ist gut so, wie es ist. Egal wie windschief und provisorisch es hier aussieht. Ein Dach über dem Kopf, immerhin. Dies ist ja nur unsere Hütte. Wenn der Sommer geht und die Tage kürzer werden, dann ist dies hier nicht alles. Es gibt noch ein anderes Zuhause.
Und irgendwann, wenn wir spüren, dass es soweit ist, ziehen wir aus der Hütte wieder aus. Genug mit dem Provisorischen und all den Löchern, durch die es hereinregnet und die wir niemals dichtkriegen. Wir ziehen in ein anderes Haus, nicht mit Händen gemacht. Ewig. Da wackelt nichts und da zieht es auch nicht. Ein Haus wie ein warmer Mantel, den man sich um die Schultern legt. Wir ziehen aus der Hütte aus. Wir ziehen in das ewige Haus ein. Wir ziehen um. Wir ziehen uns um.
Bei Paulus überlagern sich die Bilder. Häuser und Kleider und Kleider und Häuser. Ausziehen und umziehen, sagen wir beide Male. Und kennen diese Momente. Der Moment, wo alles, was dir gehört, in Kartons gepackt wird und auf die Straße gestellt. Der Abend vor dem Umzug. Die Möbelpacker haben dir den Fernseher dagelassen und einen Sessel. Und du sitzt da und der Fernsehton hallt im leeren Zimmer und morgen früh geht es los. Oder der kleine Raum mit dem Vorhang, in dem du dich ausziehen musst für eine Untersuchung und dastehst, ganz allein, nur in Unterwäsche und ewig warten musst und es zieht so vom Flur.
Das sind die Momente. Und wir haben Angst, dass es irgendwann einmal, bei dem letzten großen Umzug aus dem Leben, auch so ist. Dass wir allein sind und nichts mehr da ist, was uns vertraut war. Dass wir wie nackt dastehen, unbekleidet, unbehaust. Und keiner bringt einen warmen Mantel und legt ihn uns um die Schultern. Wenn der Sommer vorbei ist und die Tage dunkler werden, im Jahr und im Leben, dann denken wir an so etwas. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass immer wieder und gerade in diesen Wochen das Thema „Sterbehilfe“ so intensiv diskutiert wird. Wenn kranke Menschen sich den Tod wünschen, darf man ihnen dabei helfen? In allen Diskussionen wird deutlich: Man kann darüber nicht reden, ohne an sein eigenes Sterben zu denken. Dieser letzte große Umzug - wie wird er sein? Werde ich allein sein, hilflos und ausgeliefert, in einer fremden Umgebung, mit Schmerzen?
In einer Umfrage hat sich gezeigt, dass dies die größten Ängste sind, die Menschen im Blick auf das eigene Sterben haben: Die Angst, hilflos Apparaten ausgeliefert zu sein. Angst vor Schmerzen oder jemandem zur Last zu fallen. Momente, Tage, Stunden, in denen wir wie nackt dastehen oder liegen, ganz allein.
Deswegen soll es schnell gehen, das Sterben. Kein langes Leiden, sondern lieber ein Glas mit einem Medikament darin, das mir jemand auf den Nachttisch stellt. Aber ist das die Lösung? „Tötung auf Verlangen ist unnötig, wenn wir die Palliativmedizin ausweiten und Sterbende besser begleiten“, sagt der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford-Strohm. Man könnte es auch so sagen: Es wird jemand bei dir sein, wenn es soweit ist. Egal, wie lange es dauert. Du musst keine Schmerzen haben. Es wird nichts gegen deinen Willen getan, aber alles dafür, dass du den Umzug gut überstehst. Das wünsche ich mir, wenn ich an mein eigenes Sterben denke.
Das Leben ist wie eine Hütte im Wald, in der die Kinder spielen einen Sommer lang. Diese Hütte wird doch nie zum richtigen Haus, so wacklig und nie fertig. Wir haben hier nur eine Hütte, immer nur eine Hütte. Und aus dem Schmerz darüber wächst die Sehnsucht nach dem Haus. So hat Gott uns Menschen gemacht.
So sind wir denn allezeit getrost und wissen: solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn; denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben vielmehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsre Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. (2. Kor 5,6-10)
Dahinten, zwischen den Bäumen, bewegt sich etwas. Das sind wir. Wir bauen unser Leben. Das meiste ist geborgt oder geklaut. Es wackelt und es hält, manches geht nicht, manches geht gut. Und dann freuen wir uns daran. Immer machen wir Pläne und nicht immer wird etwas daraus. Es ist viel Arbeit, aber wir tun sie gerne, jeden Tag. Wir geben uns Mühe.
Und wenn die Tage dunkler werden und der Sommer vorbei ist,
dann gehen wir aus der Hütte im Wald nach Hause,
so wie ein müdes Kind abends nach Hause geht.
In das richtige Zuhause.
Und da wartet jemand auf uns.
Der sitzt schon da, am Tisch und fragt uns: Wie war’s?
Und wir fangen an zu erzählen.
Amen.
Kathrin Oxen
Kathrin Oxen, Moderatorin des Reformierten Bundes, gibt Ihnen auf reformiert-info.de jeden Sonntag Materialien für den Gottesdienst für Zuhause, dazu eine aktuelle Predigt.